Newsletter-Sonderedition, Teil 2: „A Link to Jenny’s Fantasy Stories“

***Der Text enthält Spoiler zu den Enden der Zelda-Spiele „Ocarina of Time“ und „Twilight Princess“. Diese werden im Text jeweils markiert***
Im letzten Newsletter "A Link to Jenny's Past" ging es um habe ich euch mit einigen Infos zu der Videospiel-Reihe „The Legend of Zelda“ versorgt. Hauptsächlich ging es dabei um das Worldbuilding in „Ocarina of Time“ (1998) und „Twilight Princess“ (2006). Am Ende bin ich auch etwas auf die narrative Meisterleistung im letzten Tempel von „Twilight Princess“ eingegangen, dem „Temple of Time“, der sich in einem heiligen Waldhain versteckt.
Was „The Legend of Zelda“ meiner Meinung nach vor allem richtig macht, ist die ausgewogene Mischung aus Kämpfen, Rätseln und Reden. Lassen sich diese drei Kategorien nicht auch auf (Fantasy-)Romane übertrage? Kämpfen aka Actionszenen/Heere im Kampf, Rätseln aka Geheimnisse/verschollene Artefakte finden und Reden aka Dialoge zwischen den Figuren, z.B. einer Truppe, die ein Land oder eine Person retten will?
Was auf den ersten Blick Parallelen aufweist, unterscheidet sich beim näheren Blick auf die Spiele doch von High Fantasy-Büchern wie „Harry Potter“ oder „Der Herr der Ringe“. Ich habe den „Herrn der Ringe“ nie gelesen und nur den ersten der drei Filme gesehen, aber „Harry Potter“ kenne ich aus meinen Kindheits- und Jugendtagen noch gut, als die Autorin noch als weibliche Vorreiterin von High Fantasy (in Deutschland seltsamerweise eher als „Kinder- und Jugendbuch“ verkauft) galt.

Die beiden oben genannten Werke stammen beide von britischen Autor*innen, gehören also westlichen Erzählweisen an. Dazu gehören bei Fantasy meist: ein (meist männlicher, junger) Held, eine Mentorenfigur, ein Love Interest (oft weiblich) und je nachdem eine Truppe um den Helden, oder er zieht allein ins Abenteuer gegen den ultimativen Bösewicht. Neben der Mentorenfigur, die dem anfangs passiven Helden ordentlich in den Hintern tritt oder sogar auf seiner Reise beisteht, braucht es noch ein zentrales Element für die Story: Konflikte.
Diese können innerlich wie äußerlich sein, in Nebenhandlungen oder im Hauptstrang auftreten. Wesentlich ist, dass der Konflikt aufgebaut wird, es Hindernisse zu überwinden gilt (bei Fantasy oft eine Reise durch teils beschwerliche Gegenden), der Held es schließlich zum Austragen des Konflikts (oft ein Kampf epischen Ausmaßes) schafft und am Schluss dieser Konflikt zwingend gelöst wird (bei Reihen verschiebt sich diese Konfliktlösung aufs Ende des letzten Bandes).
Meist gibt es nach dem gelösten Konflikt ein Happy End, bei dem der Held natürlich seinen Love Interest bekommt und das ganze Land in Jubel ausbricht, weil der Bösewicht auf immer besiegt wurde. Es scheint bei westlich geprägten Fantasy-Geschichten einerseits wichtig zu sein, dass die Erzählung über mehrere Bände trägt. Andererseits erwarten Lesende immer einen Konflikt zwischen Gut und Böse und vor allem dessen Lösung am Ende (fast immer: gut besiegt böse).
***Achtung, Spoiler ***
Bei den zwei untersuchten „Zelda“-Spielen gibt es zwar auch ein definitives Ende, jedoch ist dieses nicht mit klassischen Happy Ends vergleichbar. Während bei „Ocarina of Time“ am Ende wieder der Kinder-Link vor der Kinder-Zelda steht (nachdem man eine Weile den Teenager-Link gespielt hat), ist am Schluss von „Twilight Princess“ zwar das Land Hyrule vor den bösen Mächten des Zwielichts gerettet. Jedoch trennen sich auch die Wege von Link und Midna wieder, obwohl diese ihn über weite Strecken des Spiels begleitet hat.
Dabei ist Midna eindeutig als moralisch grauer Charakter angelegt, der vor allem anfangs aus rein egoistischen Zwecken handelt. Hyrule und damit Links Welt sind ihr egal, sie will ausschließlich das Reich des Zwielichts retten, aus dem sie stammt. Später erfährt man, wie dieses Reich bevölkert wurde und warum die Geschichte von Midnas Vorfahren untrennbar mit der von Link und Zelda verbunden ist.
***Spoiler Ende***
Diese Informationen erhalten Spielende jedoch nicht zu Beginn oder nicht einmal in der ersten Hälfte des Spiels. Gut das erste Drittel des Spiels verbringt Midna ausschließlich damit, Link anzuherrschen, ihn als „dumm“ zu bezeichnen und gnadenlos auszunutzen, dass sie auf ihm reiten kann, da er vom Zwielicht in einen Wolf verwandelt wurde. Wie Link tritt auch Midna tritt teils nicht in ihrer tatsächlichen, humanoiden Form auf, sondern als ein koboldähnliches Wesen mit Helm auf dem Kopf.
Anfangs wirkt sie mehr wie eine Bösewichtin und folglich denkt Link zunächst, er müsse Midna bekämpfen. Doch während die Kobold-Midna und der Wolfs-Link anfangs eine ruppige Zweckgemeinschaft bilden – er braucht sie, um unbeschadet durchs Zwielicht zu kommen und sie braucht ihn, um an ihren Gegenspieler heranzukommen, der Hyrule unterwerfen möchte –, nähern sich die beiden im Laufe des Spiels einander immer weiter an.

Dabei fungiert Midna weder als klassische Mentoren-Figur (dafür ist sie zu eigensinnig, anfangs egoistisch) noch als Love Interest, denn so nah sich Link und Midna im Laufe des Spiels auch kommen – welcher Art ihre Beziehung zueinander ist, lässt Nintendo bis zum Schluss unklar. Vermutlich ist Midna deswegen die einzige weibliche Begleiterin von Link, die sich bei Spielenden großer Beliebtheit erfreut – Links Fee Navi aus „Ocarina of Time“ ist eine der unbeliebtesten Figuren des Spiels.
Ihr seht – ein Charakter wie Midna hätte in einer klassisch-westlichen Heldenreise wenig zu suchen. Neben ihrer Rolle ist Midna noch eine Sache zu eigen, die Navi nicht aufweisen kann: Ihr Charakter wandelt sich von ruppig zu melancholisch-liebevoll, von böse zu moralisch grau. Wie hängt jedoch die Erzählweise von „Twilight Princess“ mit der Geschichte um Link und Midna zusammen und wo unterschiedet sich diese von der westlichen Heldenreise, wo nicht?
„Twilight Princess“ ähnelt teils der Heldenreise, teils einer ostasiatischen Erzählweise, die meist unter dem japanischen Begriff „Kishōtenketsu“ bekannt ist. Jede Person, die schon einen „Studio Ghibli“-Animationsfilm gesehen hat, kennt das Konzept – wenn auch vielleicht nicht mit Namen. Ghibli-Filme unterscheiden sich z.B. von Disney-Filmen durch folgende Punkte:
2. Statt dem zentralen Konflikt gibt es einen Plottwist. Beispiel: „Das Schloss im Himmel“ (Protagonistin erfährt, dass ein bestimmter Antagonist ihr näher steht, als ihr lieb ist).
3. Der Plot Twist tritt nicht in der Mitte, sondern erst gegen Ende der Erzählung auf. Beispiel: „Erinnerungen an Marnie“ (Protagonistin erfährt erst am Ende ihre wahre Verbindung zu Marnie).
4. Die Erzählung ist insgesamt ruhiger und mehr auf die Figuren fokussiert als bei Disney-Filmen. Beispiel „Mein Nachbar Totoro“ (Protagonistin entdeckt Totoro eher zufällig durch ihre jüngere Schwester, die sich in den Wald verirrt hat).
5. Es gibt häufig Charaktere, die zuerst unheimlich oder sogar böse erscheinen, sich im Nachgang jedoch als missverstanden erweisen oder eine neue Seite von sich zeigen (müssen). Beispiel: „Das wandelnde Schloss“ (Hexe aus dem Niemandsland wird von matronenhafter Bösewichtin in niedliche Oma verwandelt).
Diesen Punkten gemeinsam ist, dass sie sich des „Kishōtenketsu“ oder auf Chinesisch: „qǐchéngzhuǎnhé“ bedienen. Heutzutage ist diese als japanische Erzählweise bekannt, ursprünglich stammt sie jedoch aus China. Was bedeuten die vier Punkte „ki/qǐ“, „shō/chéng“, „ten/zhuǎn“ und „ketsu/hé“ jedoch und wie haben sich diese entwickelt? Ursprünglich stammt das Konzept aus chinesischen Gedichten, die aus vier Zeilen bestanden.
Dazu muss man wissen, dass die chinesische Sprache (Mandarin) durch die Verwendung von Schriftzeichen (Piktogrammen) sehr viel präziser und mehrdeutiger ist als Wörter im Deutschen, Englischen usw. Eine Silbe kann in Kombination mit einer weiteren Silbe etwas anderes bedeuten als allein. Außerdem ist es normal, dass beim Aussprechen (Vorlesen) Silben ähnlich betont werden, die von der Bedeutung (also verschriftlicht) jedoch sehr unterschiedliche Bedeutungen haben. Damit lässt sich hervorragend bei Poesie spielen.
Qi : After a farewell in the mountain,
cheng: Dusk falls, and I shut my firewood-made gate.
zhuan: When the spring grass is green next year,
he: I wonder if my friend will return.
Ki : Introduction
Shō : Development, Hardships
Ten : Turning Point, Complication
Ketsu : Result, Reconciliation
Aus dem obigen Gedicht von Wang Wei (699–759) wird deutlich, dass der Plot Twist erst zwischen Vers 3 und 4 einsetzt und kein direkter Konflikt ersichtlich ist, obwohl die Geschichte eines Abschieds erzählt wird. Woher kommt diese Erzählweise? Wer einen Blick ins historische China wirft, wird schnell feststellen, dass China lange nicht als „ein Reich“ existierte, als das wir es heute wahrnehmen. Stattdessen gab es kleinere Staaten, die sich gegenseitig oft bekriegten und unterwarfen (auch bekannt als „Warring States Period“).

Dem gegenüber standen auch in friedlichen Zeiten aber nicht Freiheit des Individuums („Heldenreise“) und „found familiy“ (Mentorenfiguren/Love Interest), sondern die Familie und zahlreiche Verpflichtungen. Auch im Alltag der „einfachen Leute“ gab es zahlreiche Konflikte, z.B. beim bedingungslosen Gehorsam gegenüber Eltern oder genauen Vorschriften, deren Missachtung strengstens bestraft wurde. Manchmal wurden ganze Familien ausgelöscht, wenn ein Mitglied ein Verbrechen begangen hatte. Was läge da näher, als zumindest in der Literatur ein wenig auszubrechen, ohne noch mehr Konflikte heraufzubeschwören?
Auch bei „Twilight Princess“ findet sich ein solcher später Plot Twist, jedoch vermengt mit Aspekten der Heldenreise. Link wird klar als „Held von Hyrule“ bezeichnet und ist der Einzige, der Land und Leute vom Zwielicht retten kann. Jedoch ist sein Schicksal untrennbar an das von Midna gebunden, die weder klarer Love Interest noch klare Mentorin ist, sondern eigene Pläne verfolgt. Dabei bleiben Midnas genaue Herkunft und Geschichte lange im Dunkeln.
***Spoiler Anfang***
Erst nach ungefähr ¾ des Spiels wird klar, wer Midna wirklich ist: Nicht etwa die Prinzessin Zelda, die in einer schwierigen Lage das Land Hyrule ins Zwielicht stürzen ließ, ist damit gemeint. Sondern keine geringere als Midna selbst, da sie im Reich des Zwielichts die rechtmäßige Herrscherin bzw. Prinzessin darstellt. Jedoch wurde ihr Thron von dem (eigentlichen) Bösewicht Zant gestürzt, der auch Zelda in Bedrängnis brachte.
Somit wird klar, dass nicht nur Midna und Link, sondern auch die Lichtwelt Hyrules sowie das Reich des Zwielichts untrennbar miteinander verbunden sind. Unterstrichen wird dies nochmals dadurch, dass Midnas Vorfahren aus dem Land Hyrule stammen, jedoch nach einer bösen Tat ins Reich des Zwielichts verbannt wurden. Daher ergibt es Sinn, dass Midna zu Beginn von „Twilight Princess“ eher als Bösewichtin erscheint, sich jedoch im Laufe des Spiels wandelt und so das „böse Erbe“ ihrer Vorfahren wieder rückgängig macht.
***Spoiler Ende***
Diese Verwandlung Midnas ähnelt der „Hexe des Niemandslandes“ aus „Chihiros Reise ins Zauberland“, aber umgekehrt: Die Hexe wird von der Diva mittleren Alters zur alten Frau, ihrer wahren Gestalt. Midna hingegen wird von der Koboldin zur jungen Frau, da dies ihrer wahren Gestalt entspricht. Neben diesem Plot Twist weisen jedoch sowohl „Ocarina of Time“ als auch „Twilight Princess“ noch einen weiteren auf: Der Held Link ist nicht nur an eine Prinzessin gebunden, sondern auch an den Ober-Bösewicht Ganondorf.
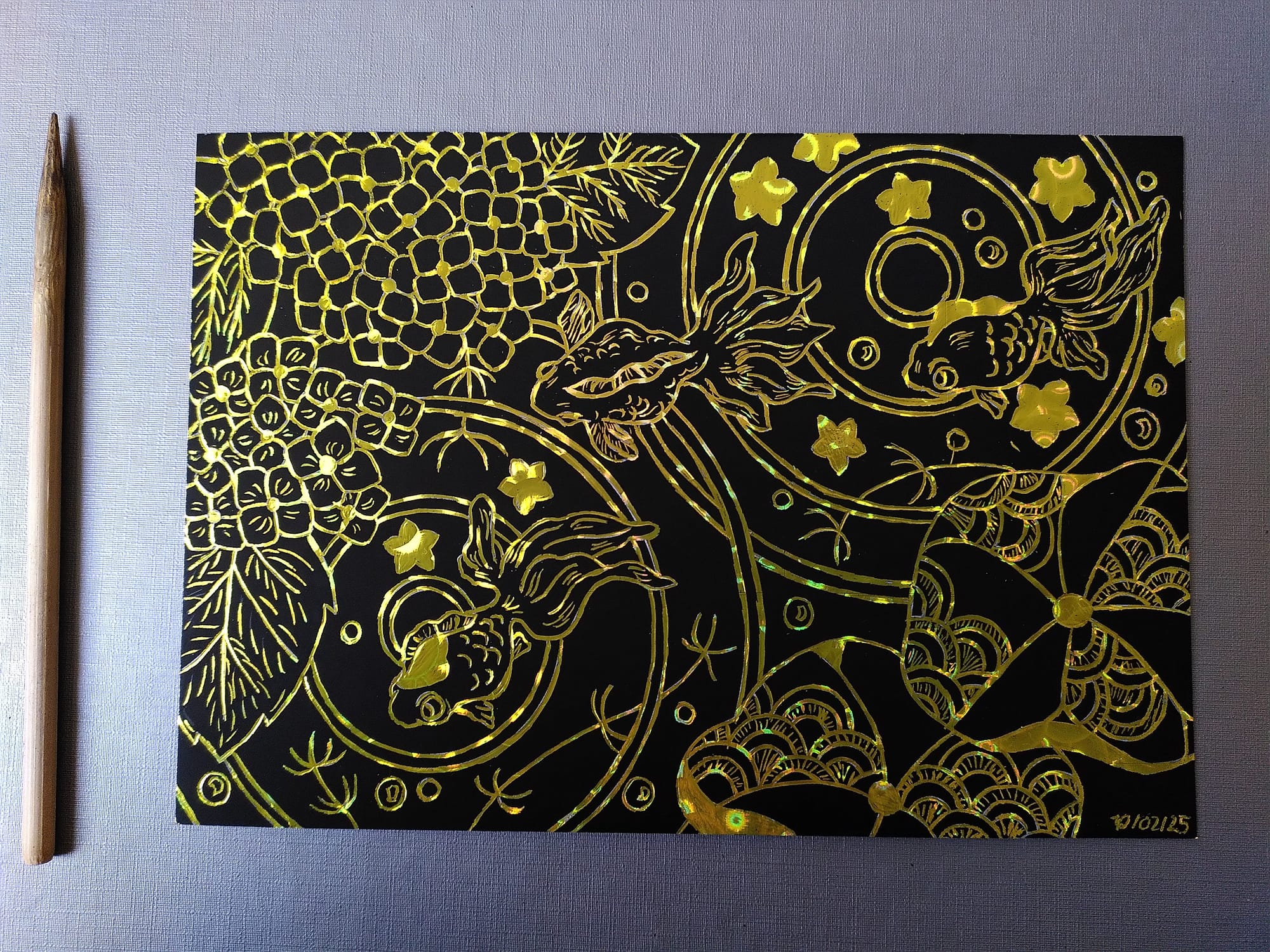
***Spoiler Anfang***
Ähnlich wie im „Schloss im Himmel“ wird so die enge Verbindung zwischen Gut und Böse, zwischen auserwählter*m Held*in und auserwähltem Bösewicht, deutlich. Auch „Ocarina of Time“ bewahrt sich den großen Plottwist fürs Ende auf: Nachdem Link Ganondorf besiegt hat und dieser in ein anderes Reich verbannt wird, schwört dieser Rache an späteren Generationen. Prinzessin Zelda schickt Link jedoch in der Zeit zurück, damit dieser (mit dem Wissen aus seinem aktuellen Leben) die Unterwerfung Hyrules durch Ganondorf verhindern kann. Ein Musterbeispiel für die Vermeidung eines Konflikts durch Umdenken!
***Spoiler Ende***
Ihr seht – die Erzählweise des „Kishōtenketsu“/„qǐchéngzhuǎnhé“ birgt einiges an sich, was sie von klassisch westlichen Heldenreisen unterscheidet. Was ich an Zelda-Spielen besonders liebe, ist jedoch die Verbindung aus westlicher und ostasiatischer Erzählweise, die insbesondere in den beiden untersuchten Spielen hervorragend gelungen ist. Für die 14-jährige, als die ich Zelda erstmals erlebte, ist diese Verbindung aus Ost und West natürlich ein einschneidendes Erlebnis gewesen.
So haben Zelda-Spiele mein Schreiben als Fantasy-Autorin zwischen Deutschland und China wesentlich stärker und nachhaltiger geprägt als Harry Potter oder die Tintenherz-Trilogie, die für klassisch westliches Erzählen stehen. Deutlich wird das an meinem allerersten Fantasy-Projekt „Wlzu“, in dem es zentral nicht um einen Konflikt geht, sondern darum, dass der Protagonist versucht, aus einer scheinbar unausweichlichen Lage auszubrechen.
Jedoch gelingt ihm dies nicht durch den offenen Kampf (zu dem kommt, weil der Bösewicht es so will), sondern durch ein radikales Umdenken. Ein Plot Twist im Zentrum statt des Konflikts Held vs. Bösewicht – kommt euch nun bekannt vor, oder? Zum Abschluss dieser Fuchsfeder-Sonderedition möchte ich euch noch ein paar Tipps zum Weiterlesen geben, falls ich euer Interesse für ostasiatische Erzählweisen oder die Geschichte Chinas nun geweckt haben sollte. Viel Spaß beim Entdecken und bis zur nächsten Fuchsfeder, in der es wieder um Autorinnen-News gehen wird!
Leseliste und Links für ostasiatische Erzählweisen (durch Klicken ausklappen):
Ostasiatische Erzählweisen:
- Überblick (Englisch): https://en.wikipedia.org/wiki/Kish%C5%8Dtenketsu
- Überblick (Deutsch): https://de.wikipedia.org/wiki/Kish%C5%8Dtenketsu
- Einführung: https://artofnarrative.com/2020/07/08/kishotenketsu-exploring-the-four-act-story-structure/ , in diesem Artikel wird auch verwiesen auf:
- https://kimyoonmiauthor.com/post/641948278831874048/worldwide-story-structures (korrektere Darstellung der Erzählweise, von einer Frau mit koreanischen Wurzeln geschrieben)
- https://mythicscribes.com/plot/kishotenketsu/ (geht auf „Kishōtenketsu“ am Beispiel eines Ghibli-Films ein und vergleicht dieses mit der 3-Akt-Struktur)
Geschichte Chinas/ostasiatischer Kontext:
- Parag Khanna: „The Future is Asian“, Kapitel 1-2: „A history of the World“. An Asian View“ und „Lessons of Asian History – for Asia and the World“. Weidenfeld & Nicolson, 2019.
- Roel Sterckx: „Chinese Thought from Confucius to Cook Ding“, Kapitel 1: „China in Time and Space“, Kapitel 4: „The Individual and the Collective“ und Kapitel 5 „Behaving Ritually“. Pelican, 2020.
- Jung Chang: „Wild Swans“. Flamingo, 1992. (Primär die Autobiografie der Autorin, ihrer Mutter und Großmutter im China des 20. Jh.s, jedoch mit einigen Ausführungen zu klassischer chinesischer Poesie und chinesischer Mythologie.)
